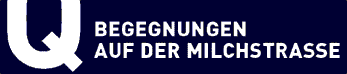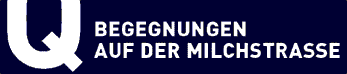|
 |
| |
|
Sommerstimmung
auf einer Schweizer Alp:
In matten Dunst gehüllte Schneegipfel, blauer Himmel, satte Wiesen,
fette Kühe. Kuhglocken klingen. Ein Mann hockt auf einer Krete
und versucht stumm, eine Kuh anzulocken. Das Bild wäre kitschig,
handelte es sich bei dem Viehhirten nicht um einen Peul aus Burkina
Faso, der zum Schutz vor der Kälte seinen Turban um den Kopf
gewickelt hat.
Die Szene steht etwa in der Mitte von ‹Q Begegnungen auf der
Milchstrasse› und bringt poetisch auf den Punkt, um was es im
Film geht: Um Menschen, die im Fremden das Vertraute entdecken und
im Vertrauten manchmal das Fremde.
‹Q› zeigt drei Viehzüchter und Milchhändler aus
Mali und Burkina Faso auf ihrer Reise in die Schweiz, wo sie mit ihren
Berufskollegen, zwei Milchbauern im Seeland und einem Käsereiunternehmer
im Berner Oberland, zusammentreffen. Zurück in ihrer Heimat berichten
sie ihren Freunden und Nachbarn von ihren Reiseerfahrungen.
Der Film ist freilich weder ein chronologisches Dokument dieser Reise,
noch eine Aneinanderreihung von Gegensätzen zwischen dem ‹reichen›
Norden und dem ‹armen› Süden. Es geht in ‹Q›
vielmehr darum, Gemeinsamkeiten auf die Spur zu kommen und Differenzen
quer zu den gängigen Klischees auszumachen. So unterscheiden
sich zwar die Wahrnehmungen des Burkinaben Dicko und des Seeländer
Grossbauern Heimberg darüber, was Fortschritt sei, aber als erfolgreiche
Agrarunternehmer finden beide gleichwohl einen Draht zueinander. Heimberg
und der Biobauer Hurter aus dem Neuenburgischen wiederum spielen ähnlich
virtuos auf der Klaviatur des kapitalistischen Agrarmarktes, unterscheiden
sich aber in ihrer Haltung zum Vieh und zur Viehwirtschaft. Hurter
und der Afrikaner Ly schliesslich räsonnieren unterschiedlich
über die Verwandtschaft des Menschen mit der Kuh, finden sich
jedoch im gleichen Diskurs über die Seele des Tieres.
 |
 |
| |
|
Auch
visuell verknüpft der Film die verschiedenen Drehorte in Westafrika
und der Schweiz zu einem einzigen Raum, der nicht geografisch, sondern
thematisch definiert ist. Obwohl die Zuschauer einen sinnlichen Eindruck
gewinnen vom Leben der westafrikanischen Peul - bei einem Kuhfest
etwa oder der Flussüberquerung einer riesigen Viehherde, bei
der morgendlichen Melkarbeit einer Familie in der Savanne und in einer
kleinen Milchfabrik, bei Versammlungen im Dorf und einem Treffen der
Viehzüchter der Sahel-Region - geschieht dies wie en passant.
‹Q› ist kein Afrikafilm, genauso wenig wie ein Film über
Schweizer Milchbauern und Käser. Gäbe es solche Erwartungen,
sie wären bald durch den unkonventionellen Filmschnitt zerstreut,
der afrikanische Szenerien und Schweizer Standorte - Ställe,
Höfe, Alpenkäserei, Viehschau, industrieller Molkereibetrieb
- mit Leichtigkeit zusammenfügt. Dass die Zuschauer manchmal
für ein paar Sekunden lang nicht wissen, wo sie sich bei einer
Kameraein-stellung gerade befinden, wirkt dabei durchaus befreiend.
Die Dramaturgie von ‹Q› ist ganz vom Gegenstand des Films
bestimmt: dem Verhältnis der Menschen zu den Kühen und damit
zur Natur, ihrem Umgang mit der Milch und damit mit dem Markt, ihrer
Reflexion über die eigenen Werthaltungen und damit über
den Fortschritt.
 |
 |
| |
|
Der
Film beginnt mit den unterschiedlichen Wahrnehmungen, die Schweizer
von Afrika und Afrikaner von Europa haben. Darauf folgen lose miteinander
verknüpfte Themenstränge: Das Verhältnis zwischen Mensch
und Vieh; die Kuh als Trägerin gesellschaftlicher Projektionen;
Ansichten über die gute Viehhaltung; die Arbeit des Melkers und
die Verarbeitung der Milchprodukte; Diskussionen über Milchmengen,
Zucht und künstliche Besamung; Ernährung und Wasser; Markt
und Globalisierung.
Schnitt und Dramaturgie erlauben dem Regisseur, beim Blick auf ein
Thema häufig die Perspektive zu wechseln. Als Zuschauer wird
man Zeuge der Mischung aus Bewunderung und Abscheu, mit der die afrikanischen
Viehzüchter die prall gefüllten Euter von Schweizer Hochleistungs-
kühen betrachten. Überfluss erscheint auf einmal exotisch.
Kurz darauf sehen wir die riesigen Viehherden reicher Viehzüchter
aus dem Sahel. Auch hier ist Überfluss im Spiel und wird von
den Afrikanern als solcher erkannt, mitsamt den nachteiligen Folgen
für das übernutzte Weideland. «Wir haben nicht die
gleichen Probleme», resümiert Amadou Dicko einmal, ein
Viehzüchter aus Burkina Faso - aber Probleme hätten alle.
Formal nutzt der Regisseur alle Gesprächsebenen, welche bei den
Begegnungen in Afrika und in der Schweiz möglich sind. Da sind
einmal Ausschnitte aus Interviews, die der Regisseur mit den Protagonisten
führt. Auf einer anderen Ebene, auf der die Filmemacher stille
Beobachter im Hintergrund bleiben, finden die direkten Begegnungen
zwischen den drei Viehzüchtern aus dem Sahel und den Schweizer
Landwirten statt. Dabei treffen die Gesprächspartner jeweils
paarweise aufeinander: Boubacar Sadou Ly, ein in Toulouse ausgebildeter
Veterinärmediziner, der in Burkina Faso eine Vereinigung der
Viehzüchter des Sahel gegründet hat, besucht den Hof des
Biobauern Hurter. Amadou Dicko, ein ländlicher Viehzüchter,
trifft auf Hanspeter Reust, den Besitzer eines Käsereibetriebs,
der ehrgeizig nach Exportmärkten Ausschau hält. Hamadoun
Dicko, wie Amadou Dicko aus Burkina Faso stammend, aber in der Hauptstadt
Ouagadougou und der Handelsstadt Bobo Doulasso heimisch und Besitzer
zahlreicher Grossherden, diskutiert mit dem Seeländer Grossbauer
Hanspeter Heimberg.
Zentral ist eine dritte Gesprächsebene: der Austausch der Beobachtungen
und Gedanken der Afrikaner unter sich. Wie ein roter Faden zieht sich
eine Einstellung durch den Film, die Amadou Dicko und Hamadoun Dicko
auf dem Rücksitz des Autos zeigt, von dem aus beide das Mittelland
beobachten und in ihrer Sprache kommentieren. Zurück in Westafrika,
werden die Rückkehrer von neugierigen Verwandten und Berufskollegen
bedrängt. Ihre Reisereminiszenzen lösen zuweilen eine Heiterkeit
aus, die ansteckend wirkt.
Aber Amadou Dicko, Hamadoun Dicko und Boubacar Ly nehmen nicht die
gleichen Geschichten aus der Schweiz mit nach Hause. Das Besondere
an ‹Q› ist gerade die unterschiedliche Sichtweise der Protagonisten,
die den Zuschauern damit allmählich als Charaktere vertraut werden.
Amadou Dicko wird immer staunen über Bauernhöfe, Milchfabriken,
Tiefkühllager, Strassen und Wälder in der Schweiz und über
das ganze Land. Hamadoun Dicko wägt nüchtern ab, wovon man
lernen könne und was für Westafrika unpassend sei. Boubacar
Ly dagegen ist überzeugt, dass der westliche Materialismus zwingend
in eine Sackgasse führe. Er besucht aus eigenem Antrieb die Schweiz,
um an Versammlungen teilzunehmen und im Namen der Vereinigung der
Viehzüchter des Sahel für eine tiergerechte und genügsamere
Viehwirtschaft zu plädieren.
‹Q› thematisiert damit unaufdringlich den technischen und
sozialen Fortschritt und seine gesellschaftlichen Kosten. Diese Frage
stellt sich für afrikanische Viehzüchter ebenso wie für
Schweizer Viehhalter und Milchhändler. In der Sahelzone sind
fortschreitende Wüstenbildung und klimatische Veränderungen,
aber auch neue, demokratische Organisationsformen der Produzenten
die Antriebskräfte des Wandels. In der Schweiz sind es die Liberalisierung
im Agrarmarkt, Besitzkonzentration, Globalisierung, die Chancen einer
betrieblichen Diversifizierungsstrategie.
Dass die Schweizer Viehhalter auf solche und verwandte Fragen unterschiedliche
Antworten geben, ist zumindest uns Schweizer oder europäischen
Zuschauern vertraut: Der biologisch-dynamische Bauer Ueli Hurter lehnt
die künstliche Besamung und intensive Stallhaltung, wie sie vom
Landwirt Heimberg praktiziert wird, ab. Darüber hinaus macht
‹Q› durch die Auswahl der afrikanischen Viehzüchter
und ihrer verschiedenen Einschätzungen und Meinungen transparent,
dass die Diskussion darüber, wieviel Nachahmung nötig und
wieviel eigener Fortschritt möglich sei, um die ungleichen Entwicklungstempi
der afrikanischen und der abendländischen Gesellschaften zu bewältigen,
auch in Afrika pluralistisch geführt wird.
|